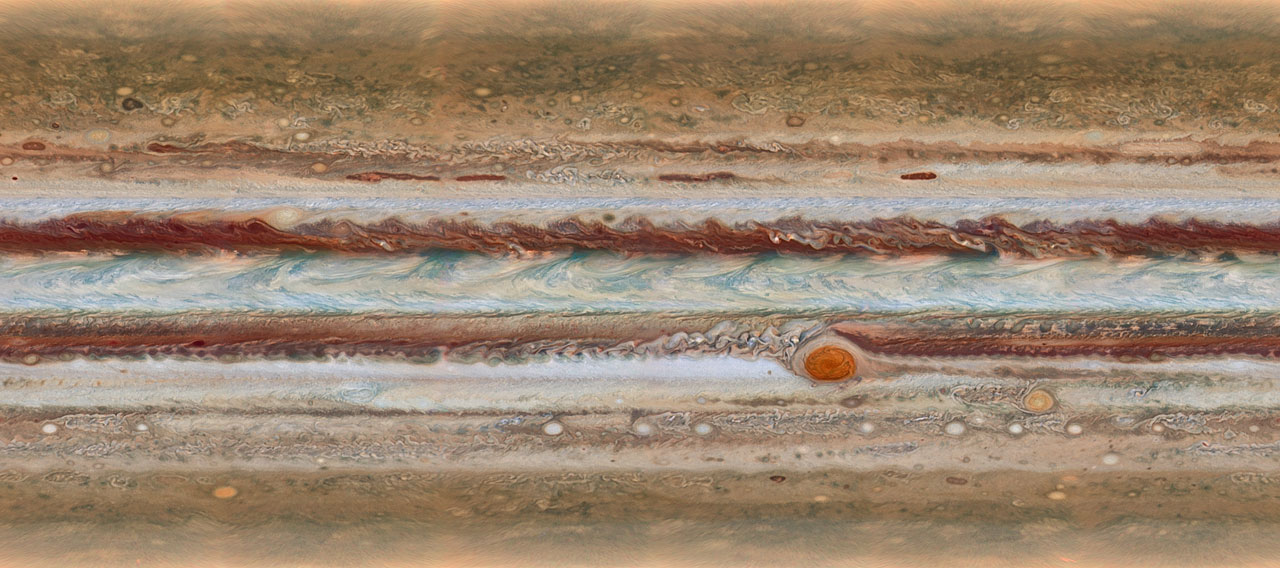Bildcredit und Bildrechte: Chris Kotsiopoulos (GreekSky)
Keine Angst. Die Sterne fallen nicht vom Himmel, und in eurer Nachbarschaft spuken keine Gespenster. Doch auf diesem gruseligen Bild eines exzentrischen, verlassenen alten Hauses im Mondlicht sieht so aus, als wären hier Geister. Das Bild ist ein Genuss fürs Auge. Es nützt den Trick gestapelter Mehrfachbelichtung. Dafür wurden 60 Aufnahmen je 25 Sekunden belichtet.
Während der Belichtung zogen die Sterne konzentrische Bögen um den Nordpol am Himmel, weil der Planet Erde um seine Achse rotiert. Der Himmelsnordpol wird praktischerweise vom hellen Polarstern markiert. Er liegt über den Spitzen der verlassenen Ruine. Der Fotografen stand in der Tür und war in eine Decke gewickelt. Seine Bewegungen während der Aufnahmen wurden zu einer geisterhaften Erscheinung kombiniert. Auch Jack O’Lantern war dort und wünschte ein fröhlichen Abend vor Allerheiligen (All Hallows’ Eve)!